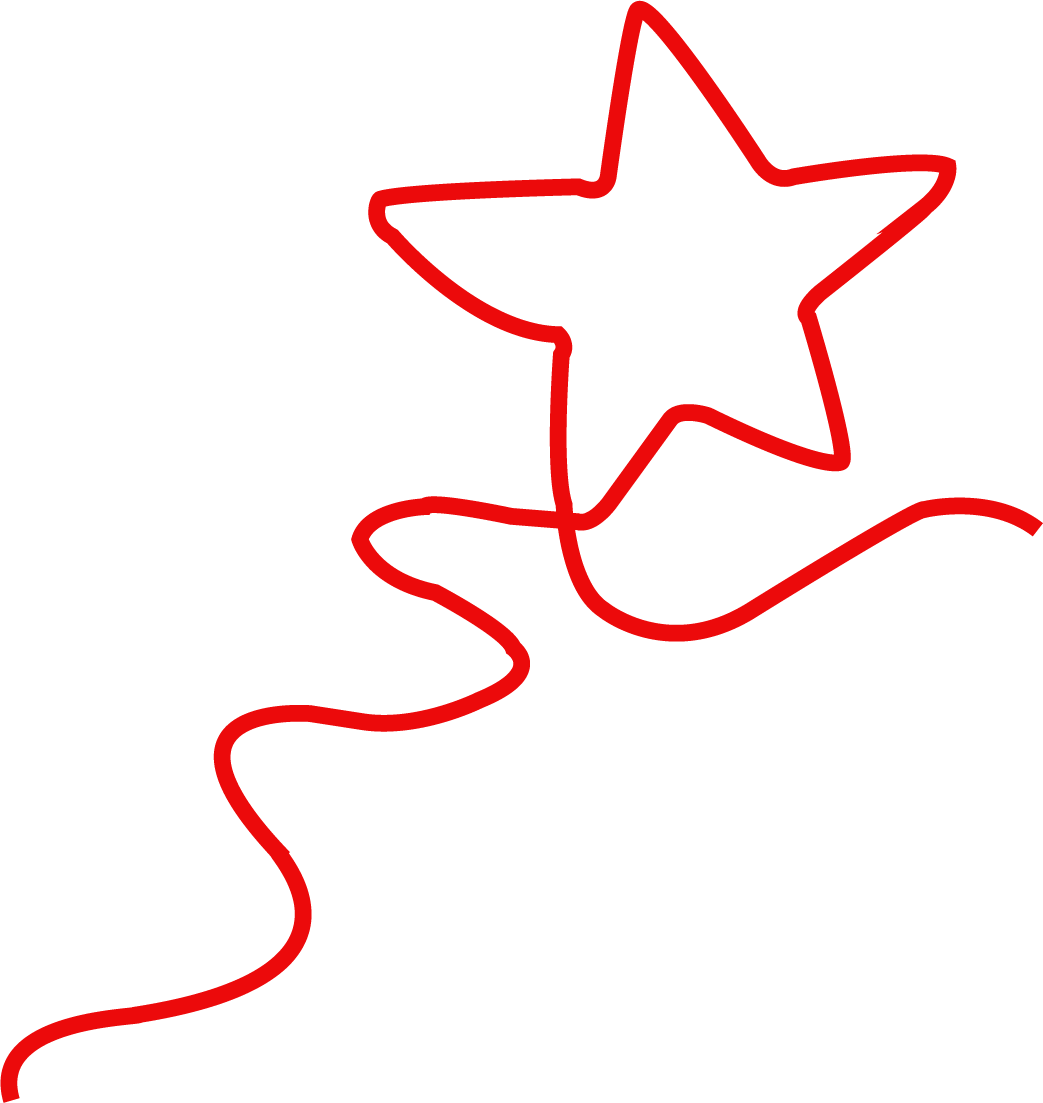Maskulinisierung der Ärzt*innenschaft?
Der Anteil an Frauen in der Ärzteschaft in der Schweiz steigt weiter. Bei den ärztlichen Führungspositionen setzt sich die neue Geschlechterverteilung bisher allerdings nur langsam durch. Während die Medizin in den unteren Rängen weiter «feminisiert» wird, verblieben 2019 87.2 % der Chefarztpositionen in männlicher Hand (FMH-Statistik 2019). Wir haben also immer noch eine maskulinisierte Ärzteschaft, trotz einer Frauenüberzahl in den unteren Rängen.
Aber Moment mal, weshalb wird eigentlich nie über die maskulinisierte Ärzteschaft geschrieben oder gesprochen? Weil der Mann nach wie vor der Normalfall ist, auch unter ÄrztInnen und ForscherInnen und deswegen nur die «Abweichung Ärztin» benannt werden muss. Die Zunahme an Ärztinnen wird infolgedessen unter dem Begriff Feminisierung diskutiert. Und wenn über Feminisierung geschrieben wird, ist damit meist eine problematische, wenn auch offenbar unaufhaltbare, Entwicklung gemeint, die unter anderem folgende Ärgernisse mit sich bringt: Teilzeit, Kinderbetreuung, Co-Leitungen, Schwangerschaften, Mutterschaftsurlaube – das ganze anstrengende Zeug eben. Aber hier hört es nicht auf: Von vielen Frauen werden Ansprüche auf eine wohlwollendere und anständigere Kommunikation erhoben. Schluss soll zudem sein mit alten Seilschaften und unfairer Verteilung von Forschungsgeldern. Aber sind nicht gerade diese Merkmale maskulinisierter Ärzteschaft? Weshalb sollte man sie freiwillig hergeben?
Und noch ein interessantes Phänomen: In der maskulinisierten Ärzteschaft war und ist die Familie sogar ein Statussymbol, solange eine Ehefrau dem Arzt den Rücken freihält. So ein Foto mit allen Kindern auf dem Schreibtisch, aufgereiht wie Orgelpfeifen, zeugt von Erfolg auf allen Ebenen. Der Bastelkram am mütterlichen Arbeitsplatz hingegen zeigt nur: Sie kann ja nicht wirklich 100 % Einsatz bringen.
Nun wollen sich auch etliche der jüngeren Männer nicht mehr mit maskulinisierten Spielen herumschlagen. Sie wollen keine 70-Stunden-Woche, sie wollen Teilzeit arbeiten, 80% oder 90%, und billigen den herrschenden Ton des Chefs nicht mehr, der in jedem Rapport die jungen Assistentinnen zum Weinen bringt. Diese Männer müssen aber mehr mitbringen als eine neue Haltung, sie müssen echte Alliierte der Frauen sein. Sie müssen bereit sein Stellen zu teilen und Klartext reden, wenn sie Sexismus begegnen. Als Vertreter der Generation Y oder Z ein bisschen fortschrittlich zu sein, reicht nicht aus, um einen Kulturwandel herbeizuführen.
Aber halt: Weshalb brauchen wir diesen Kulturwandel in der ärztlichen Führungswelt überhaupt? Es hat doch alles wunderbar funktioniert im maskulinisiereten Umfeld.
Leider ist dies ein Irrtum: Wir haben sowohl Evidenz in Bezug auf einen positiven Zusammenhang zwischen der Qualität von Führung und der Qualität der PatientInnenversorgung. Wir haben weiterhin Evidenz, dass PatientInnen von Ärztinnen profitieren, weil sich diese im Unterschied zu ihren männlichen Kollegen enger an Guidelines halten und besser zuhören und kommunizieren. Gemäss einer Studie hatten PatientInnen, die von einer Ärztin behandelt wurden, ein 4 Prozent tieferes (relatives) Risiko, innerhalb von 30 Tagen nach Spitaleintritt zu sterben, und ein 5 Prozent kleineres Risiko, in dieser Zeit erneut hospitalisiert zu werden.
Dieser Zusammenhang war bei acht häufigen Krankheiten und verschiedenen Schweregraden der Erkrankung nachweisbar (Jama Internal Medicine, December 2016).
Unter dem Begriff Gendermedizin haben wir zudem wesentliche Erkenntnisse darüber, dass Medizin dem Geschlecht der PatientientInnen mehr Rechnung tragen muss. Denn eine Frau ist nicht einfach eine Sonderform des Mannes (Ihr wisst schon, die Rippe …). Die Berücksichtigung geschlechtlicher Unterschiede (Abbau von Medikamenten, Beeinflussung durch Hormone, Symptome von Herzinfarkten) muss bereits in der Forschung anfangen, zum Beispiel bei der Wahl der Forschungsthemen und der Art der Durchführung der Studien, beispielsweise, indem man nicht mehr nur männliche Mäuse beforscht.
Und damit Gendermedizin ernsthaft betrieben wird und damit mehr Patientinnen entsprechend gut behandelt werden können, braucht es auf allen Stufen in der medizinischen Forschung und Führung Gleichstellung und Geschlechterparität.
Damit wir nicht mehr von feminisierter und maskulinisierter Medizin sprechen müssen, sondern nur noch von Spitzenqualität und Empathie.
So kann ich Sie unterstützen:
Lehrgang “Frau Doktor führt!”, Leadership, Empowerment und AHA-Erlebnisse für Ärztinnen, neue Daten Herbst 2023!
Kurs in Bern “Nicht mit mir!” Vom Umgang mit Fouls und Attacken am 13.1.2023
Beratung von Organisationen zur Förderung von Frauenkarrieren und Steigern von Diversity
Bild von unsplash