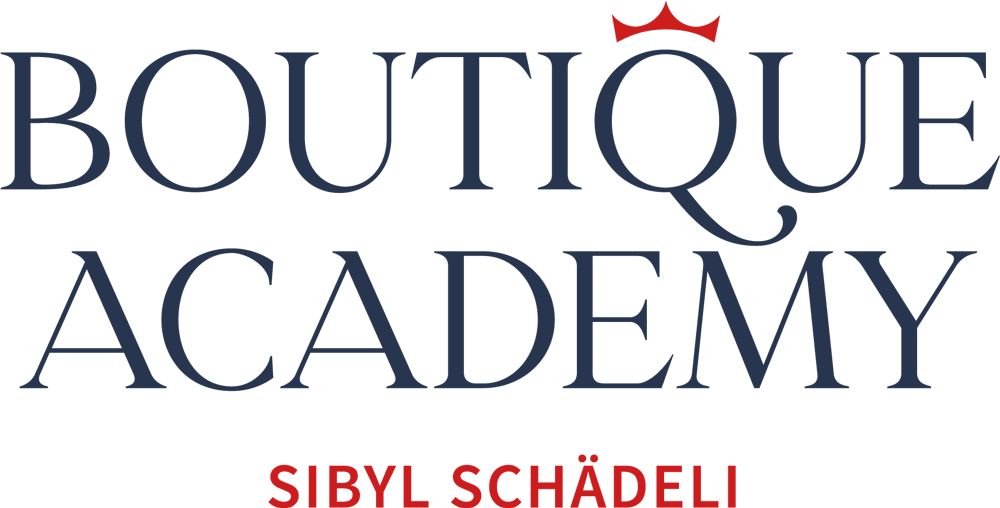Vor einigen Jahren betreute ich eine Ärztin im Coaching.
Sie war seit vielen Jahren Oberärztin – hochqualifiziert, verlässlich, die tragende Säule ihrer Klinik. Keine, die laut auftrat, aber eine, auf die man sich verlassen konnte. Ihre Arbeit war präzise, diszipliniert, unermüdlich. Als eine Stelle als Leitende Ärztin frei wurde, wusste sie: Es wird eng.
Nicht, weil sie nicht gut genug war. Sondern, weil sie an ihrer Position zu wertvoll war.
Wer ein Spital kennt, weiss: Es gibt Menschen, die den Betrieb stabilisieren, die klinisch und organisatorisch alles zusammenhalten. Diese Menschen sind so wichtig, dass sie für die Organisation fast unersetzlich wirken – und genau das steht ihrer eigenen Weiterentwicklung im Weg. Bei ihr kam etwas dazu: Die Habil war noch nicht abgeschlossen. Ein idealer Vorwand, um sie zurückzuhalten. Ein willkommenes Argument, um einen Kollegen vorzuziehen – so, wie ich es in meinen Coachings immer wieder sehe.
Wir bereiteten ihr Gespräch mit dem Klinikchef vor.
Sie ging ruhig, sachlich, klar hinein. Ohne Drohung, aber mit einer deutlichen Botschaft: Wenn sich nichts bewegt, wird sie gehen.
Kurz darauf bekam sie die Position.
Und dazu einen verbindlichen Fahrplan für ihre Habilitation.
Diese Geschichte steht für viele andere. Und sie zeigt, wo Ärztinnenkarrieren heute immer noch brechen.
1. Wenn Verantwortung ohne Sichtbarkeit bleibt
Der Übergang von der Oberärztin zur Leitenden Ärztin ist für viele Frauen der schwierigste Schritt ihrer gesamten Karriere. Nicht, weil sie plötzlich weniger leisten. Sondern, weil die Oberarztfunktion im Spital eine paradoxe Rolle hat: enorm viel operative Verantwortung, aber kaum institutionelle Sichtbarkeit.
Eine Oberärztin führt im Alltag sehr wohl – Teams, Abläufe, klinische Entscheidungen. Sie trägt Patientenverantwortung, sie stabilisiert Prozesse, sie hält das System am Laufen. Aber im formalen Sinn führt sie kaum. Sie stellt kein Personal ein. Sie hat selten Einblick in Budget, Strategie, Qualitätsprozesse oder organisatorische Entwicklungen. Sie sitzt in wenigen Entscheidungsrunden. Sie kann kaum zeigen, wie sie führt – obwohl sie jeden Tag führt.
Diese unsichtbare Verantwortung fällt Frauen überdurchschnittlich oft zum Nachteil aus. Männer übernehmen an der gleichen Stelle häufiger Aufgaben mit institutioneller Wirkung: ein Projekt, ein Mandat, ein Gremium, eine Schnittstellenfunktion. Und genau diese Elemente tauchen später im Dossier einer leitenden Stelle auf – während die klinische Spitzenleistung einer Oberärztin als selbstverständlich gilt.
Hinzu kommt ein strukturelles Muster, das ich in vielen Coachings beobachte: Frauen suchen diese Schnittstellen weniger aktiv, Männer werden dafür schneller angefragt. Damit entsteht ein Erfahrungsgefälle, das nichts mit Kompetenz zu tun hat, aber enormen Einfluss auf die Beförderung hat.
Wenn eine Ärztin zur leitenden Funktion wechseln will, muss sie sich als Führungsperson präsentieren – ohne je echte Führung im institutionellen Sinn ausgeübt haben zu dürfen. Der Schritt ist damit nicht nur schwierig, er ist spät, oft zu spät. Und er wird vielen Frauen zum Stolperstein, obwohl sie längst auf diesem Niveau arbeiten.
2. Wenn eine Qualifikation über Karrieren entscheidet
Die zweite grosse Hürde ist die Habilitation – und zwar nicht als wissenschaftlicher Meilenstein, sondern als Machtinstrument. Offiziell kann man auch befördert werden, wenn sie noch läuft. Praktisch tun es Männer häufiger. Frauen hingegen warten oft, bis sie die Kriterien vollständig erfüllen, bevor sie sich bewerben oder eine Beförderung einfordern. Sie treten nicht mit einer „fast fertigen“ Habil in ein Beförderungsgespräch – selbst dann nicht, wenn es institutionell möglich wäre. Sie sind an dieser Stelle zu gewissenhaft, zu korrekt, zu sehr darauf fokussiert, alles lückenlos zu erfüllen, bevor sie den nächsten Schritt verlangen.
Dieses Warten ist keine „Charaktersache“. Es ist eine kluge, nachvollziehbare Reaktion auf ein System, das Frauen härter beurteilt und weniger Spielraum lässt. Doch genau dadurch geraten sie in einen strukturellen Nachteil.
Denn die Habilitation ist steuerbar:
- Man kann sie verzögern, indem man keine Forschungszeit gibt.
- Man kann sie beschleunigen, indem man Projekte zuspricht.
- Man kann sie behindern, indem man Prioritäten anders setzt.
- Man kann sie vorantreiben, indem man Türen zu Netzwerken öffnet.
Wer befördern will, gibt Unterstützung. Wer bremsen will, entzieht sie.
Und genau das passiert in vielen Fällen, die ich im Coaching begleite.
Für Ärztinnen bedeutet das: Sie bringen Leistung, publizieren, arbeiten – aber ob sie sichtbar werden, hängt weniger von ihnen ab als von der Entscheidung, ob jemand ihre Habil priorisiert. Männer werden an dieser Stelle häufiger gefördert, Frauen häufiger „noch etwas warten gelassen“.
Die Folge ist ein chronischer Zeitverlust: Während Frauen warten, bis „alles stimmt“, haben Männer den Karriereschritt längst gemacht. Nicht, weil sie besser wären. Sondern, weil sie nicht warten mussten.
Die Habil ist damit nicht nur eine Qualifikation. Sie ist eine Stellschraube, die Karrieren ermöglicht – oder verhindert.
3. Wenn die Machtfrage entscheidet – und mittelmässige Männer profitieren
Viele Programme zur Förderung von Ärztinnen sind gut gemeint. Mentoring, Kurse, Netzwerke, Workshops – alles hilfreich. Aber sie verändern nicht das Grundproblem: Die Spitzenpositionen bleiben knapp. Und jede Besetzung ist eine Frage der Macht, nicht der guten Absichten.
In einer hierarchischen Organisation gibt es oben nur wenige Plätze. Wenn mehr Frauen diese Positionen erreichen sollen, heisst das zwangsläufig, dass weniger Männer sie bekommen. Und zwar nicht die Ausnahmebegabten, die jeden Vergleich bestehen würden. Sondern vor allem jene mittelmässigen Männer, die bisher ohne grosse Konkurrenz durchgerutscht sind, weil das System auf ihre Laufbahnen ausgerichtet war und sie von Netzwerken getragen wurden, die ihnen selbstverständlich zur Verfügung standen.
Diese Dynamik wird selten offen angesprochen. Stattdessen wirkt es manchmal, als könnte man die Spitze einfach verbreitern – als wäre Gleichstellung eine Art harmonische Erweiterung, bei der alle gewinnen. Doch die Pyramide bleibt eine Pyramide. Man kann nicht plötzlich doppelt so viele Leitungsfunktionen schaffen. Gleichstellung bedeutet konkret: Männer müssten Macht abgeben, Einfluss teilen und Karriereschritte anderen überlassen. Genau das aber passiert nicht freiwillig.
Solange diese Realität nicht anerkannt wird, bleibt die Verantwortung für Gleichstellung bei den Frauen hängen – sie sollen sich weiterbilden, sich sichtbarer machen, sich vernetzen, sich anpassen. Und dennoch ist das Ergebnis immer gleich: Nicht die durchschnittlichen Männer verlieren. Sondern bestqualifizierte Frauen, deren Karrieren spät, langsam und oft unnötig hart verlaufen.
Bestätigt durch aktuelle Forschung
An dieser Stelle hat mich der neue Divmed-Bericht des CHESS (2025) leider sehr bestätigt. Die drei zentralen Bruchstellen, die ich in meinem Coachingalltag seit Jahren beobachte, finden sich dort schwarz auf weiss wieder:
– der kritische Verlust an Ärztinnen beim Sprung von der Oberärztin zur Leitenden Ärztin
– die strukturelle Bedeutung und Steuerbarkeit des Habilitationsprozesses
– und die begrenzte Wirkung von Frauenförderungsprogrammen angesichts realer Machtstrukturen
Die Erkenntnisse aus Divmed entsprechen exakt dem, was Ärztinnen in Coachings berichten – über verschiedene Kliniken, verschiedene Fachbereiche und verschiedene Karrierestufen hinweg.
Quelle:
CHESS – Divmed Bericht «Diversität und Chancengleichheit beim medizinischen Führungskräftenachwuchs», Edition CHESS 1/2025, Universität Zürich.